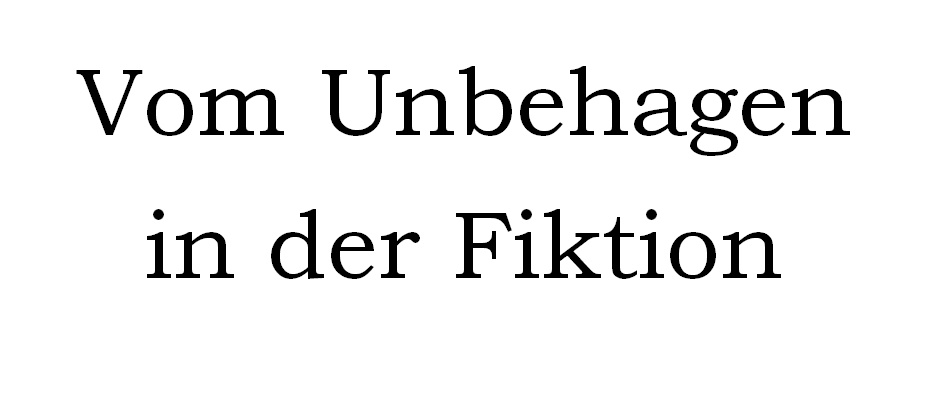Veranstaltungsreihe: Vom Unbehagen in der Fiktion
Das Netzwerk der Literaturhäuser hat in Kooperation mit der Bundeszentrale für Politische Bildung eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Vom Unbehagen in der Fiktion“ veranstaltet. Auch auf diesem Blog hat sich in diesem Jahr gezeigt, dass sich immer wieder Bücher finden, deren Stoff auch dokumentarisch Realitäten abbildet, die Distanz zwischen Fakt und Fiktion schrumpft. Gleichzeitig sorgen Debatten über Fake News und Präsidenten die Fakten beugen dafür, dass Bereiche, die man eigentlich klar getrennt wahrnehmen möchte verschwimmen.
Der Trend zu realistischen Romanen ist nicht neu und hat mich auch schon während meines Germanistikstudiums begleitet. In meiner Abschlussarbeit habe ich mich intensiv mit autofiktionaler Prosa beschäftigt. Dies alles greift die Veranstaltungsreihe auf. Für diesen Blog hat Stefan Katzenbach zwei Veranstaltungen digital verfolgt und darüber geschrieben. Stefan hat mit mir gemeinsam Germanistik studiert und ist bei vielen Lesungs-, Festival- und Messebesuchen mein Begleiter gewesen. Er wird den Blog in Zukunft bei Berichten aus dem Literaturbetrieb unterstützen und wir werden sicherlich auch einige Hintergründe aus Literatur- und Kulturwissenschaft im kommenden Jahr gemeinsam betrachten.
Nun folgt der Bericht von Stefan zur Veranstaltung der Reihe in Frankfurt.
Die Diskussionsrunden sind auch unter dem Link
https://www.literaturhaus.net/projekte/vom-unbehagen-in-der-fiktion
zu finden.
„Wir müssen als Gesellschaft mit der Pluralität von Texten umgehen“
Im Rahmen der Reihe „Das Unbehagen in der Fiktion“ diskutierten am 14.12. Jan Wiele, Paula Diehl, Daniel Schreiber und Jan Wilm im Literaturhaus Frankfurt über den konstatierten „Boom“ von autobiographischen Texten in der Gegenwartsliteratur sowie die Notwendigkeit kompetent zwischen Fakten und Fiktion unterscheiden zu können.
Muss Kunst deutlich machen, dass sie Kunst ist? Diese uralte Frage kam unlängst wieder auf, als der britische Kulturminister Oliver Dowden sich dafür starkmachte, dass die Netflix-Serie „The Crown“ ihre Zuschauer*innen mittels einer klaren Kennzeichnung darüber informieren solle, dass es sich bei der Serie um reine Fiktion handle. Von Bedeutung ist diese Forderung auch deswegen, weil die Serie in Teilen das Leben der britischen Königsfamilie darstellt.
Dieses Ereignis nahm Moderator Jan Wiele als Einstieg, um die Frage zu stellen, ob es einen generellen Warnhinweis für fiktionale Inhalte in der Literatur geben sollte. Für die Politikwissenschaftlerin Paula Diehl ist die Sache klar: „Die politische Kultur sieht einen solchen Warnhinweis als Verzweiflungstat, die Zuschauer*innen nehmen ihn nicht ernst.“ Vielmehr würde sich durch die Warnung der intendierte Effekt umkehren, das „Spiel mit Gespieltem und nicht Gespieltem kommt wieder“, ist sich Diehl sicher.
Auch für den Schriftsteller Daniel Schreiber ist ein solcher Hinweis unnötig: „Die Zuschauer*innen sehen die Serie nicht 1:1 als Realität“, schließlich hätten sie genug „Medienkompetenz für Fiktionen“, ist er sich sicher und meint: „Eine solche Warnung hinkt der Zeit hinterher.“
Der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Jan Wilm hingegen sähe einen Warnhinweis aus ästhetischer Sicht als produktiv an: „Literatur wird nicht die Welt retten. Warnt was das Zeug hält – erst wenn die Literatur puritanisch wird, dann sind wieder Grenzüberschreitungen möglich“, zeigte er sich überzeugt. Eine solche Grenzüberschreitung gäbe es bereits in Bezug auf die Politik, diese sei immer schließlich „immer fiktional“ und deswegen nicht strikt von der Literatur zu trennen.
„Es gibt keinen wahren Zugriff aufs Ich“
Ein generelles Problem sieht auch Paula Diehl in der Fiktion nicht: „Wir brauchen eine gewisse Konstruktion“, zeigte sie sich überzeugt, diese werde erst problematisch, wenn es keine Trennung mehr gäbe, die Politik den Begriff „beliebig nach Laune“ verwenden und die Bedingungen des Gemeinwohls nicht mehr erfüllen würde.
Mit der Zuschreibung Politik sei fiktional, hat Daniel Schreiber Probleme: „Ich finde es nicht sinnvoll, Politik als Fiktion zu bezeichnen, das tut der Politik Unrecht und lässt Kritikmöglichkeiten nicht zu“, warnte er. Ein gutes Beispiel wohin dies führen könne, sei Trumps „Mythos“ von der verlorenen Wahl in den USA.
Für Jan Wilm ist nicht die Zuschreibung der Fiktionalität das Problem, sondern die Verwendung derselben: „Die Regierenden verkaufen Fiktion als Wirklichkeit“, konstatierte er und forderte: „Wenn nicht Kunstschaffende den Begriff der Fiktion verwenden, dann wird er benutzt und geklaut.“
Auf eine gefährliche Veränderung des Fiktions-Begriffs wies Paula Diehl hin, die alternativen Fakten. Durch diese sei die „Vorstellung, dass es eine unabhängige Realität gibt, dahin“ und die „Basis der Verständigung“ auch, weil es gemäß dieser Argumentation keinen Konsens mehr gäbe und auch keine „Notwendigkeit einer gemeinsamen Realität“.
Eine solche Sichtweise habe „reale Konsequenzen“, deswegen sieht sie die Möglichkeit der Unterscheidung zwischen Fakt und Fiktion als „gesellschaftspolitisch lebensnotwendig“ an.
Was aber bedeutet dies nun für den literarischen Diskurs der Authentizität? Wenn das vermeintlich Authentische immer schon in den fiktionalen Diskurs eingebunden, ist „gibt es dann nicht eine Potenzierung, die immer höher fiktionalisiert?“, fragte Moderator Jan Wiele.
Für Jan Wilm ist „alles fiktional“, es gäbe keinen „wahren Zugriff aufs Ich“, zeigte sich der Literaturwissenschaftler überzeugt und stellte die Möglichkeit der Trennung selbst in Frage: „Vielleicht ist die Kompetenz der Unterscheidung selbst fiktional?“ Ohnehin gäbe es keinen Zugriff auf alle biographischen Ereignisse der Autor*innen, man befände sich in der Literatur im Medium der Sprache und damit automatisch auf „fiktionalem Terrain“. Spannender als die Frage nach Fakten oder Fiktion ist für Wilm vielmehr: „Wie glauben Autoren an Autofiktion?“. Diese biete die „Möglichkeit einer anderen Spielebene“, eines autofiktionalen Zugriffs „in und außerhalb des Textes“.
Welche gesellschaftliche Rolle spielt die Fiktion?
Für Moderator Jan Wiele stellte sich dann die Frage ob es, ähnlich wie im Journalismus, auch in der Literatur klarere Genrebezeichnungen von Texten geben sollte. Für Daniel Schreiber ist dies keine praktikable Option: „Genrebezeichnungen erreichen nicht viel, wir müssen als Gesellschaft mit der Pluralität von Texten umgehen“, zeigte er sich überzeugt.
Paula Diehl will allerdings nicht gänzlich auf Genrebezeichnungen verzichten: „Ich sehe die Notwendigkeit journalistische Grenzen beizubehalten“, sagte sie. gleichzeitig gäbe es in der politischen Kulturforschung Strömungen, die darauf verwiesen, dass junge Menschen „ihre Informationen eher nicht journalistisch beziehen“, weswegen sie nicht sicher sei, „ob Genres wirkmächtig bleiben“.
Politisch relevant wird die Relevanz der Fiktion aber auch in der Diskussion um die „Cancel Culture“ – der Absage von Veranstaltungen aufgrund unliebsamer Inhalte. „Wie weit ist es bis zum Verbot der Fiktion?“ fragte Moderator Jan Wiele.
Während Daniel Schreiber darin kein „großes gesellschaftliches Thema“ sieht, warnte Jan Wilm vor der Cancel Culture: „Das Problem der Cancel Culture ist existent und ein Geschenk an die Rechten“, warnte er. Argumentiert werde in solchen Kreisen nämlich: „Liberale wollen uns alles verbieten, die machen das auch untereinander“, außerdem werde suggeriert, dass die Fiktion weniger Wert sei als die Wirklichkeit. „Deswegen ist es so wichtig, dass alles Fiktion ist, wir dürfen uns das nicht wegnehmen lassen“, forderte er.
Stefan Katzenbach